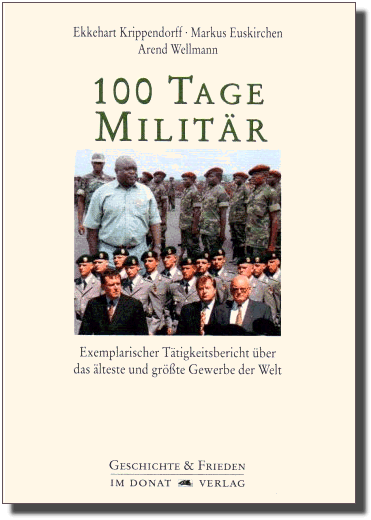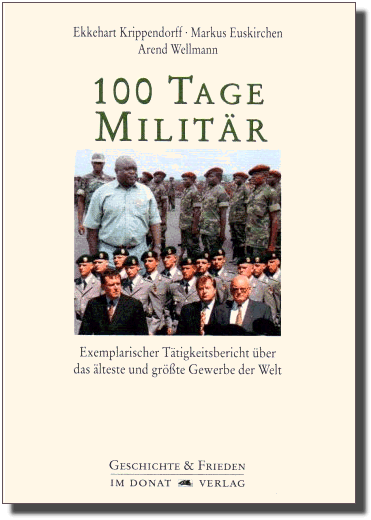|
|
Dem “Projekt Militärchronik”,
aus dem die hier vorgestellten „100 Tage Militär“ hervorgingen, geht
es darum, die Alltäglichkeit dieser gesellschaftlichen Institution,
seine “Universalität”, für einen begrenzten Zeitraum exemplarisch
zu dokumentieren, seine weltweiten Aktivitäten zu erfassen und in
einer gut lesbaren Form zu präsentieren. Auch wer sich seit längerem
beruflich mit Militär beschäftigt, wird von der Fülle der
Aktivitäten, die bereits in den normalen Tageszeitungen verzeichnet
werden, überrascht sein. Militär ist im täglichen Leben
ständig präsent und aktiv. Die tatsächliche physische Gewaltanwendung,
ist dabei nur die Spitze eines Eisbergs und der eigentliche "Krieg" gar
nur ein seltener Gipfel. Trotzdem: 'Überall, jederzeit und mit allen
Waffen' – so das offenbar-geheime Motto der US-amerikanischen Militärstrategie
seit Mitte der achtziger Jahre – wird Krieg vorbereitet, geplant und in
unerklärten Aktionen auch geführt. Die Übergänge zwischen
Krieg und Frieden sind fließend geworden, und was wir heute als Frieden
im Weltsystem und zwischen den Staaten bezeichnen, scheint, auch und gerade
aus der Perspektive des Militärs, nur ein – sehr fragiler – Ausnahmezustand
zu sein, der die latente Gewalt nur verdeckt. Überall wird staatlich
auf- und technologisch umgerüstet, und der Waffenhandel blüht.
Das “Projekt Militärchronik” ist kein Konkurrenzunternehmen zur (hamburger)
"Kriegsursachenforschung", (1) das ehrgeiziger konzipiert ist und
eine eindeutig wissenschaftliche Öffentlichkeit 'bedienen' will. Und
es überschneidet sich nicht mit dem Erkenntnisinteresse der "Friedensursachenforschung",
(2) der es um gesellschaftspolitische Projekte und Projektionen geht.
Uns geht es um das Militär als dem materiellen Substrat von Krieg
– und dem Gegner langfristiger, dauerhafter Friedensstrukturen. Insofern
liegt dem “Projekt Militärchronik” und dem hier präsentierten
exemplarischen Ausschnitt eine explizitere Werk-Orientierung zugrunde:
die der Militär-Kritik.
Die “100 Tage” entstanden
im Rahmen einer dreisemestrigen Lehrveranstaltung mit Studierenden im Grund-
und Hauptstudium und ohne jegliche Hilfsmittel von Dritten. So waren wir
angewiesen auf die Auswertung solcher Materialien (Tageszeitungen, Fachzeitschriften),
die in den berliner Bibliotheken vorfindbar sind und die die Kapazitäten
der Seminarteilnehmer nicht über stiegen. Trotzdem wurde das schiere
Volumen der für den vorgesehenen Berichtszeitraum von neun Monaten
(zwei Semestern) gesammelten Nachrichten so umfangreich, daß wir
uns entschlossen, daraus nur die gewissermaßen "magisch" besetzten
100 Tage auszuschneiden (November 1996 bis Februar 1997), die noch immer
ein genügend anschauliches Bild zu geben in der Lage sind. Nicht nur,
aber auch deswegen ist das “Projekt Militärchronik” in seiner Reichweite
deutlich begrenzter als die erwähnten Forschungsprojekte, die eine
möglichst vollständige Erfassung eines langen Zeitraumes, z.T.
bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurückreichend, anstreben.
Allerdings geht unser Unternehmen
über jene Kriegsursachen- bzw. Friedensursachenforschung insofern
hinaus, als nicht nur Kriegs- oder Friedensprozesse untersucht und dargestellt
werden sollen, sondern der Versuch unternommen wird, die eher unspektakulären
Aktivitäten des Militärs weltweit zu erfassen, zu strukturieren
und als Chronik darzustellen. Die “100 Tage” thematisieren natürlich
auch aktuelle Kampfhandlungen ebenso wie Friedensprozesse, aber das Netz
der zu erfassenden Informationen ist weiter ausgespannt, indem hier nach
Möglichkeit alle militärischen Aktivitäten – von Manövern
bis zur Budgetplanung, von der Rüstungsbeschaffung bis zu Gerichtsprozessen
– dokumentiert werden. Das Projekt geht also mit auch begrifflich erheblich
erweiterten Kategorien an die Arbeit als der Kriegs- oder Friedensursachenforschung
zugrunde, – bleibt zugleich bewußt in Bezug auf die zeitliche Reichweite
hinter ihr zurück.
Nur auf den ersten Blick
schien das Vorhaben theoretisch problemlos: Im Verlaufe des Seminars stellten
sich immer mehr Fragen, die geklärt werden mußten, angefangen
mit der schlichten Grundfrage: Was ist überhaupt Militär? |
(1) Vgl. u.a.
Klaus Jürgen Gantzel (Hg.), Kriege in der Dritten Welt. Theoretische
und methodische Probleme der Kriegsursachenforschung - Fallstudien (= Schriftenreihe
der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung e.V. (AFK)
Bd. XII), Baden-Baden 1988
(2) Vgl. u.a. Volker Matthies
(Hg.), Vom Krieg zum Frieden. Kriegsbeendigung und Friedenskonsolidierung,
Bremen 1995 |
|
 |
Über den Begriff Militär
Die Frage, “Was ist Militär”,
erscheint nur auf den ersten Blick einfach zu beantworten: Militär,
so scheint es, ist jene soziale Organisation, die uniformiert, kaserniert,
bewaffnet und dem Prinzip von Befehl und Gehorsam unterworfen ist, und
die von einem Staat unterhalten wird, um sein Territorium vor anderen Staaten
zu schützen. Eine solche schlichte Definition findet aber in der politischen
Wirklichkeit so gut wie keine Entsprechung – sie erfaßt sie überhaupt
nicht. |
|
-
Bereits das Merkmal, daß
das Militär den Staat nach außen schütze, stimmt bestenfalls
noch für das 18. und frühe 19. Jahrhundert. Seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges hat es zwar nur wenige zwischenstaatliche Kriege gegeben,
wohl aber eine eindrucksvolle Kette von militärisch ausgetragenen
Konflikten. Die überwiegende Anzahl der Kriege der letzten 50 Jahre
hat innerhalb von Staatsgrenzen stattgefunden (3) oder ist aus der
Auflösung von Staaten, dem Zerfall staatlicher Autorität hervorgegangen.
Als aktuelle Beispiele seien hier Somalia oder Afghanistan genannt, oder
den Zeitraum unserer Chronik dominierend: Kongo. Eine Definition von Militär,
die Staatlichkeit und die “Verteidigung” des Staates als Charakteristikum
aufzählt, wird also den beobachtbaren Gegebenheiten der heutigen Welt
nicht gerecht. Militär in jenem strengen Sinne ist also eine Institution,
die in nur wenigen Staaten zu finden ist.
-
Auch zwei weitere Merkmale –
Uniformierung und Kasernierung – sind für eine den heutigen Verhältnissen
adäquate Definition von Militär nur begrenzt brauchbar: Ein großer
Teil der zeitgenössischen Kriege wird mit Einheiten geführt,
auf die das Kriterium “uniformiert” oder gar “kaserniert” nur marginal
oder gar nicht zutreffend ist: Die kurdische PKK in der Türkei, die
Verbände der Mudschahedin in Afghanistan oder die UCK im Kosovo könnten
nicht als “Militär” beschrieben werden, wenn Uniformierung oder Kasernierung
unverzichtbarer Bestandteil der Militärdefinition wäre – aber
was könnte noch beschrieben werden, wenn solche Kampftruppen aus der
Definition ausgeschlossen würden?
-
Übrig bleiben zwei Merkmale,
die wir dann auch unserer Chronik zugrundegelegt haben: Das Prinzip von
Befehl und Gehorsam, das sich in allen kämpfenden Verbänden findet,
und – weitaus wichtiger – der Zweck der sozialen Organisation: die kollektive
physische Gewaltanwendung. Gerade dieser Zweck scheint uns das einzige
Kriterium zu sein, das eine Militärorganisation von anderen sozialen
Gruppen – Parteien, Industrieverbänden oder Kleintierzüchtervereinen
– qualitativ unterscheidet. Der Zweck des Militärs ist der Krieg oder
die Vorbereitung des Krieges, auch wenn die konkreten organisatorischen
Formen, die dafür historisch oder aktuell entwickelt werden, sich
deutlich voneinander unterscheiden. Auf der Mikro-Ebene gleicht kein Militär
exakt dem anderen, wiewohl es auf der Makro-Ebene, der des Zwecks, dann
kaum Unterschiede gibt.
|
(3)
Vgl. u.a. Klaus Jürgen Gantzel/ Thorsten Schwinghammer, Die Kriege
nach dem Zweiten Weltkrieg 1945-1992. Daten und Tendenzen, Hamburg 1995 |
| Militär nach dem Kriterium
des Zwecks "Krieg" zu definieren, wirft zwar immer noch Abgrenzungsprobleme
auf (beispielsweise ob die korsische Seperationsbewegung als “Militär”
zu betrachten ist), aber solche Probleme können und müssen mit
einer Setzung – wir entschieden uns in diesem Fall für Nein – pragmatisch
behandelt werden. Zum Abschluß sei ein letztes Merkmal von Militär
erwähnt, das zentral zu dessen Verständnis gehört und auch
bei uns (u.a. unter V.) dokumentiert wird: Das Militär ist männlich.
Männlich über alle Grenzen hinweg, auch wenn Frauen in vielen
Armeen auch als Kombattantinnen zugelassen werden. (4) |
(4)
siehe dazu u.a. Astrid Albrecht-Heide, Patriarchat, Militär und der
moderne Nationalstaat, in: antimilitarismus information Nr. 6/1990 |
|
 |
Der Gegenstand unseres Interesses:
militärische Aktivitäten
Auch die Frage, was “militärische
Aktivitäten” seien, ist auf den ersten Blick leicht beantwortbar:
Sicherlich, sobald organisiert und kollektiv physische Gewalt angewendet,
oder der Krieg vorbereitet wird, d.h. Manöver durchgeführt und
Rüstungsbeschaffungen, Personal- oder Strategieplanungen betrieben
werden, ist die Antwort, “dies sind originär militärische Aktivitäten”,
noch einfach. Aber unser “Projekt Militärchronik” will dabei nicht
stehenbleiben. Wir fragen nach dem gesellschaftlichen Handeln der Militärs
auch jenseits der ihm offiziell und konstitutionell zugeschriebenen engen
Aufgaben. Deshalb mußte der gesamte Bereich der öffentlichen
Präsenz des Militärs – Paraden, Kranzniederlegungen, Gelöbnisse,
Flugschauen, Tage der offenen Tür und Staatsbesuche, um nur einige
zu nennen – miteinbezogen werden. Hier wird der Unterschied zu anderen
Ansätzen besonders deutlich: Das “Projekt Militärchronik” begreift
Militär als eine Institution sui generis, weil sie alle Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens durchdringt und prägt – Militär ist
eben kein Zweckverband neben anderen, sondern gehört in das Zentrum
der Politik und der staatlichen Existenz. Die Landesverteidigung, also
das, wofür Militär theoretisch zuständig ist, erweist sich
als nur eine, und keineswegs die wichtigste militärische Beschäftigung.
Das Militär ist offenbar
gesellschaftlich derart akzeptiert, daß seine allgegenwärtige
Präsenz in der Öffentlichkeit als selbstverständlich hingenommen
wird, und die Vorstellung, ein Staat, der von niemandem bedroht wird, könnte
auf sein Militär verzichten, extreme Irritationen und Verunsicherungen
auslöst. Darum gingen wir berichtend auch der Frage nach: Was tut
das Militär, um als Institution diesen hohen Stellenwert inne zu haben,
und anscheinend fortwährend erfolgreich zu reproduzieren?
Das Militärische durchdringt
die Gesellschaft weitaus stärker, als es uns zumeist bewußt
ist. Seine bloße Existenz scheint bereits als rationale Begründung
auszureichen: Weil es Militär gibt, ist seine Existenz bereits gerechtfertigt.
Zugleich wird die in Weltmaßstab epidemische physische Gewaltanwendung
als eine der möglichen und als möglich gedachten Konfliktlösungen
immer wieder reproduziert, wird der Krieg zu einem “sozial akzeptierten
Tatbestand”. Wenn die „100 Tage” versuchen, die sehr unterschiedlichen
Aktivitäten des Militärs weltweit zu dokumentieren, so geht es
auch darum, Ansatzpunkte zu nachhaltiger Militärkritik zu geben: Das
Militär schafft eben die Probleme, für deren Lösung es sich
dann selbst empfiehlt – es ist selbst das Problem. |
|
|
 |
Zu Vorgehensweise und der daraus
entstandenen Systematik
Die dritte Schwierigkeit, die
sich auftat, war die Frage nach Darstellungsweise und Strukturierung des
Materials. Es gab zwei Möglichkeiten: eine Chronologie oder – wofür
wir uns schließlich entschieden – eine Chronik der Ereignisse und
Aktivitäten.
Eine Chronologie hätte
Tag für Tag nacheinander alle militärisch relevanten Vorkommnisse
einfach aufgelistet. Da sich jeden Tag 30, 40, 50 oder noch mehr Notizen
und Berichte in den Zeitungen finden lassen, die das Militär zum Gegenstand
haben, hätte zwar dessen massive Präsenz mittels Quantität
dramatisch deutlich werden lassen. Die Chronologie wurde aber von uns fallengelassen,
weil diese Form der Darstellung die Möglichkeit, das Geschehen als
Leser oder Leserin strukturell zu erfassen, verhindert hätte. Niemand
kann eine derart massive Auflistung von Schlagzeilen lesen.
Die Chronik versucht hingegen,
die Ereignisse nicht nur faktisch zu registrieren, sondern sie eher als
Geschichte zu erzählen. Auch wenn dabei manche Ereignisse verloren
gehen, erschien uns diese Form der Darstellung vorteilhaft, weil sie lesbar
ist. So kann sie der Intention, militärische Aktivitäten weltweit
darzustellen, zu kommentieren und der Kritik zu überantworten, weitaus
näher kommen. Damit nicht nur Fakten aufgelistet sondern eine Geschichte
erzählt werden kann, müssen die Nachrichten thematisch sortiert
und in einen Sinnzusammenhang gebracht werden. Da wir uns hierbei nicht
von einer geographischen – und damit länderzentrierten – Darstellung
den Blick versperren lassen wollten, galt es ein eigenes Ordnungsschema
zu entwickeln. Dabei entstand eine Struktur in drei Ebenen: Zunächst
thematisch, erst darunter geographisch und wiederum darunter zeitlich,
wobei Vor- und Rückgriffe nicht ausgeschlossen wurden.
Das wichtigste Ordnungskriterium
findet sich auf der obersten Ebene, in der thematischen Gliederung. Schließlich,
nach langen und intensiven Diskussionen, entstand eine Einteilung in zehn
Abschnitten. Diese inhaltliche Gliederung und die Begründungen für
die einzelnen Rubriken oder Abschnitte bilden so etwas wie den analytischen
Kern unserer Arbeit und reflektieren unsere Erfahrungen und Erkenntnisse,
die aus der Beschäftigung mit dem Datenmaterial entstanden sind. |
 |